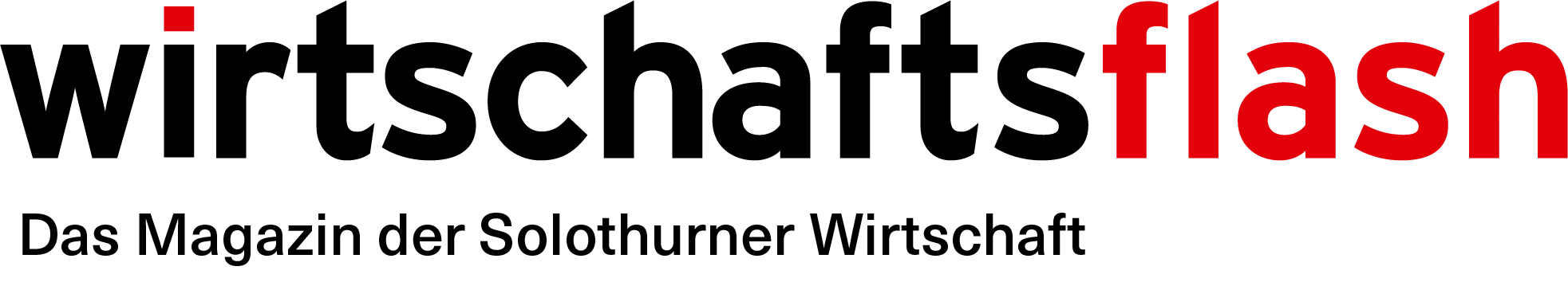Seit geraumer Zeit bekundet die Politik Mühe, die Art und Weise der Zusammenarbeit mit der EU zu regeln. Da sich der EU-Binnenmarkt regulatorisch weiterentwickelt, gemäss aktueller EU-Doktrin ohne ein Institutionelles Abkommen (InstA) aber laufende bilaterale Verträge nicht mehr aktualisiert und keine neuen Verträge mehr abgeschlossen werden sollen, wird in der Schweiz eine Erosion des bilateralen Wegs befürchtet.
Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU sind einem schleichenden Prozess der Entfremdung ausgesetzt. Erstmals sichtbar wurde dies bei der Nichtgewährung der Börsenäquivalenz Mitte 2019, zuletzt aufgrund geänderter Prozesse für die Zertifizierung neuer Bahnwaggons. Als Folge davon können einzelne Kompositionen von Schweizer Bahnunternehmen bis zu einer Rezertifizierung unter EU-Recht nicht mehr im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt werden.
Ökonomisch stärker ins Gewicht fällt die Nicht-Äquivalenz im Bereich der Medizintechnikprodukte und der In-Vitro-Diagnostika. Obwohl die Schweiz ihre Vorschriften analog der revidierten EU-Rechtstexte aufdatierte, entschied Brüssel aus politischen Gründen, die formelle Äquivalenz zu verweigern. Unternehmen aus der Schweiz müssen seither einen zusätzlichen administrativen und oft auch zeitlichen Aufwand auf sich nehmen, um ihre Produkte weiterhin im EU-Binnenmarkt verkaufen zu können. Schätzungen gehen von einmaligen Anpassungskosten von über 110 Millionen Franken und jährlich wiederkehrenden Mehrkosten von mehr als 75 Millionen Franken aus. Als Nächstes folgen die Maschinen- sowie die Pharmaindustrie; aufgrund der hohen Bedeutung dieser beiden Branchen für den Industriestandort Schweiz dürften die Kosten eine Milliarde übersteigen.
Zum ganzen Artikel von Patrick Dümmler geht’s hier.
Bildlegende: Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU sind einem schleichenden Prozess der Entfremdung ausgesetzt.